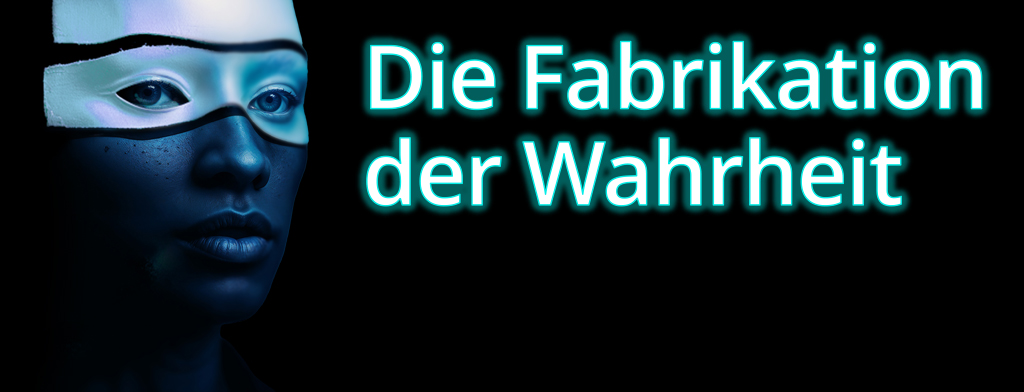Nichts ist, wie es scheint? Zum Zusammenhang von Verschwörungsglauben, Esoterik und Religion
Manche Menschen in Deutschland und weltweit sind davon überzeugt, dass „nichts ist, wie es scheint“ (Butter 2018). Hinter komplexen gesellschaftlichen Prozessen vermuten sie einen Plan, der vermeintlich von mächtigen Eliten ausgeheckt wurde und der Bevölkerung schaden soll. Sie teilen die Welt ein in Gut und Böse, Schwarz und Weiß und geben einigen wenigen Personen die Verantwortung für vielschichtige globale Entwicklungen. Empirisch wird die Anfälligkeit für Verschwörungserzählungen erfasst über Aussagen wie „Die meisten Menschen erkennen nicht, in welchem Ausmaß unser Leben durch Verschwörungen bestimmt wird, die im Geheimen ausgeheckt werden“ und „Es gibt geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben“ (Leipziger Autoritarismus Studie 2022).
Conspirituality (Ward/Voas 2011, Asprem/Dyrendal 2015) beschreibt das Phänomen, dass Anfälligkeit für Verschwörungsmentalität häufig mit esoterischen Vorstellungen einhergeht. Dies lässt sich auch anhand der Leipziger Autoritarismus Studie nachzeichnen: So konnten Dilling et al. (2022) zeigen, dass Verschwörungsgläubige sich in sechs Cluster unterteilen lassen, von denen drei auch esoterischen Vorstellungen etwas abgewinnen können. Basierend auf denselben Daten möchte dieser Vortrag den Blick auf Verschwörungsnarrative und ihre Zusammenhänge mit Paraglauben weiten und auch die Beziehungen zu religiösen Einstellungen herausstellen. Zentral dabei sind die Rolle des religiösen Fundamentalismus und die Frage, inwiefern bestimmte religiöse Überzeugungen Verschwörungserzählungen auch klar entgegenstehen.
Dr. Verena Schneider ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Religionssoziologie an der Universität Leipzig. Nach ihrem Studium der Medien- und Kulturwissenschaft in Düsseldorf und Nantes promovierte sie an der Universität Halle-Wittenberg zu den Wirkungen des Protestantismus auf Einstellungen und Wertorientierungen in den USA und Deutschland. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Religiosität und Vorurteile, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, politische Kulturforschung, Sozialkapital und gesellschaftlicher Zusammenhalt.